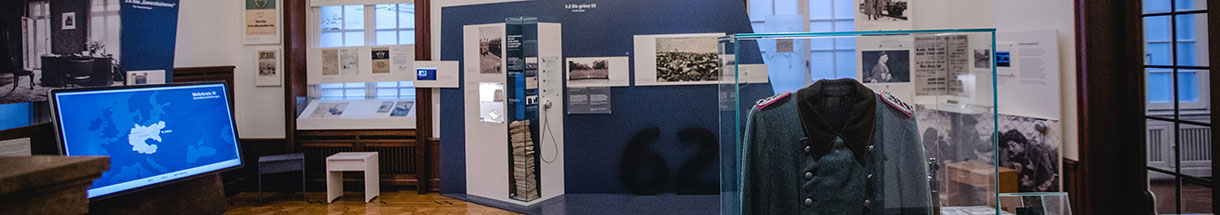Seiteninhalt
Webinar mit Lukas Esser
"Da wurde ja gar nicht heldenhaft gekämpft"

Lukas Esser im Webinar
Dass Matrizen in der Schule nicht nur im Matheunterricht interessant sein und Kompasse nicht nur Himmelsrichtungen, sondern auch Emotionen anzeigen können, zeigte Lukas Esser in einem Webinar über Schülervorstellungen zum Krieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion.
Im Rahmen der Reihe „Junge Wissenschaft“ führte Peter Römer, wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter der Villa ten Hompel, ein Gespräch mit Lukas Esser, einem ehemaligem FSJler der Villa, über dessen Masterarbeit mit dem Titel: „‚Da wurde ja gar nicht heldenhaft gekämpft‘ – Schülervorstellungen zum Krieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion 1941-1945“.
Die Veranstaltung war ein Mix aus Interview und der Interaktion mit dem Publikum über eine Zoom-Videokonferenz, sodass im Rahmen der Ausführungen Lukas Essers fruchtbare Diskussionen über die Schüleraussagen, wie auch die Implikation dieser für die Forschung und den Schulunterricht, entstanden.
Im Gespräch erklärte Lukas Esser, der jüngst seine Prüfung als Lehramtsanwärter bestanden hat, zunächst die Methodik seiner Arbeit. Um Schüleraussagen zum Krieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion, die er in Interviews mit einem Geschichts-Leistungskurs sammelte, sowohl in gesamtgesellschaftliche Deutungsmuster, als auch neueste Erkenntnisse der Täterforschung einzuordnen, habe er eine Matrix der Täterforschung erstellt.
Die Interviews, in denen Lukas Esser die Schüler/innen zu verschiedensten Themenkomplexen des Krieges gegen die Sowjetunion, wie die Kriegsziele, die Kriegsniederlage oder den Kriegsgerichtsbarkeitserlass, befragte, geben Aufschluss darüber, wie unterschiedlich die Deutungsmuster der Forschung und die gesellschaftlich entlastenden Deutungsmuster der Schülerinnen und Schüler sind.
Ein markanter Punkt der Ausführungen Lukas Essers war, dass es den Schülerinnen und Schülern an Wissen über die Beteiligung der Wehrmacht und den zeitlichen und räumlichen Ablauf des Kriegszuges fehle. Es sei ihnen nicht bekannt, durch welche Länder die Wehrmacht gezogen sei. Gerade diese, später auch als „bloodlands“ bekannt gewordenen Staaten, seien aber Schauplatz eines Großteils des Vernichtungskrieges geworden. Dieses Unwissen sei auch eine Motivation gewesen, weshalb er sich in seiner Arbeit auf den Krieg der Wehrmacht gegen die Sowjetunion konzentrierte.
Ein Grund für das geringe Wissen der Schülerinnen und Schüler über den Vernichtungskrieg, in dem auch die Wehrmacht eine Rolle spielte, sei auch die in Schulbüchern verkürzte Darstellung, die zudem nachgewiesenermaßen eher mitleidende Adjektive für die Wehrmacht als für die Rote Armee einsetzten und von der Wehrmacht im Passiv sprachen, sodass es für Schülerinnen und Schüler schwierig sei, diese als handelnd zu erkennen.
Im Gegensatz zum Wissen über den Vernichtungskrieg sei das Wissen über Kriegsschauplätze wie Stalingrad hingegen enorm, was dem medialen Einfluss, besonders eingängiger Dokumentationen, aktuellen Netflix-Produktionen und Ego-Shootern, geschuldet sei und die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung dieser Schlachten überschätzen ließe.
Zu den Kriegszielen des Deutschen Reiches befragt, äußerten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise das der „Gewinnung von Lebensraum im Osten“. Eine Aussage, die Lukas Esser vorstellte, argumentierte hier entsprechend seiner Tätermatrix funktionalistisch, aber „hitlerisierte“ dieses Ziel zugleich, indem sie das Ziel als alleine von Hitler ausgerufen sah und somit andere Akteure, wie die OHL oder die Wissenschaft, entlastete.
Ein weiteres von den Schülerinnen und Schülern identifiziertes Kriegsziel war die „Bekämpfung des Kommunismus“. Indem Kommunisten als Gegner des Faschismus beschrieben wurden, die von der Wehrmacht bekämpft werden mussten, beschrieben die Schülerinnen und Schüler den Krieg in einem schwarz/weiß-Muster, in dem jegliche Wertung der Kriegsabsichten und ideologischen Überzeugungen verloren ging.
Lukas Esser erklärte weiterhin, dass den Schülerinnen und Schülern das Verständnis fehle, dass das Gedankengut des Nationalsozialismus nicht nach Kriegsende 1945 einfach verschwand, sondern dieses überdauerte. Dies führe auch dazu, dass ihnen die Thematik der Opferkonkurrenz nicht bewusst sei, warum man sich daran stören könnte, dass die Schlacht bei Stalingrad nicht mehr als Niederlage wahrgenommen wurde. Umso wichtiger sei es, dass im Geschichtsunterricht auch auf Debatten der Erinnerungskultur eingegangen wird.
Ein weiteres zentrales Ergebnis der vorgestellten Arbeit waren die Einschätzungen der Handlungsspielräume der Wehrmacht, die die Schülerinnen und Schüler vornahmen, nachdem Lukas Esser sie mit dem Kriegsgerichtbarkeitserlasses vertraut gemacht hatte. Hier dämonisierten die Schülerinnen und Schüler die „NS-Elite“, viktimisierten die Wehrmacht und argumentierten mit dem Gruppendruck und der Kameradschaft. Allerdings schätzten sie den Handlungsspielraum, den der Kriegsgerichtsbarkeitserlass den Soldaten gab, als gering bzw. als nicht bestehend ein, was auch verdeutliche, dass neueste Forschungsergebnisse oftmals der Gesellschaft nicht bekannt sind und diese nicht durchdringen.
Aus seinen Ergebnissen erarbeitete Lukas Esser außerdem Impulse für die Praxis.
So schlägt er vor, die Kooperation von Wehrmacht, SS und Polizeieinheiten den Schülerinnen und Schülern am Beispiel des Massakers von Babi Jar („Im Schatten von Auschwitz“ der größte Massenerschießungsort) vor Augen zu führen. Die Ortschaft habe das Potential, ein Lernort über kooperative Massenerschießungen zu werden. Zudem solle die Heterogenität der Täter aufgezeigt werden und der rassenideologische Vernichtungskrieg nicht länger im Kontext gegen des Zweiten Weltkriegs unterrichtet werden.
Zudem sollten laut Esser erinnerungskulturelle Debatten wie jene um die Hamburger Wehrmachtsausstellung genutzt werden, um den Schülerinnen und Schülern vor Augen zu führen, welcher gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse es bedurfte, um gesellschaftlichen Konsens über Dinge wie den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung zu schaffen. So könnte auch aktuellen Versuchen von Rechtspopulisten, die „Leistungen von Wehrmachtssoldaten in beiden Weltkriegen“ wieder umzudeuten, entgegengewirkt werden.